„Demokratische Freiheit fällt nicht vom Himmel“
Vor fünf Jahren demonstrierten in Belarus Hunderttausende gegen die gefälschte Präsidentschaftswahl. Wie blicken wir heute darauf? Ingo Petz erzählt in seinem Buch „Rasender Stillstand“, was die Protestbewegung antrieb und wie es das Regime mit Rückendeckung von Putin schaffte, sich an der Macht zu halten.
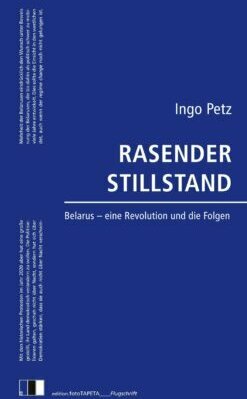
Was ist das Geheimnis des belarusischen Sommers 2020? Warum konnten sich die Proteste gegen die gefälschten Wahlen anders als zuvor zu jenem Zeitpunkt zu einer derartigen Massenprotestbewegung ausweiten?
Das sind verschiedene Entwicklungslinien zusammen mit zufälligen Ereignissen, die im Jahr 2020 kulminieren. Im Jahr 2020 selbst war das vor allem die Corona-Pandemie. In Belarus war es so, dass Lukaschenka gesagt hat: „Es wird keine Maßnahmen gegen dieses Virus geben." Und sich noch über Leute lustig gemacht hat, die krank geworden sind. Der Volkskümmerer, der „Batka Lukaschenka“ hat in dem Augenblick ein menschenverachtendes Gesicht an den Tag gelegt. Die Gesellschaft hat sich dagegen gewehrt, denn die Menschen haben ja mitbekommen, dass ihre Freunde in Krankenhäusern landen, dass Leute sterben – an Lungenentzündung, wie es offiziell hieß. Sie haben selbst Initiativen gestartet, haben Hygienemittel organisiert, haben Geld gesammelt, haben die staatlichen Stellen unter Druck gesetzt. Diese Erfahrung der Selbstorganisation einerseits und andererseits des Unmuts gegenüber dem Staat, das war einer der Impulse, die sie dann auch in die Massenproteste reingetragen haben.
Zusätzlich genährt wurde das ganze durch die Zeit des Vorwahlkampfes. Da ist der Staat wie bei anderen Präsidentschaftswahlen gegen die erfolgreichsten potenziellen Kandidaten vorgegangen. Ende Mai, Anfang Juni 2020 sind alle bekannten oppositionellen Politiker eigentlich schon wegverhaftet worden. Nach diesen Verhaftungen sind die Leute schon auf die Straßen gegangen, haben protestiert, haben Menschenketten gebildet, haben sich vor der Zentralen Wahlkommission versammelt. Das alles vor dem Hintergrund, dass es ab 2017 schon größeren Unmut in der Gesellschaft gab, wegen fehlender Zukunftsperspektiven, der Korruption im Regime. Das hat immer wieder zu Protesten geführt, nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch auf dem Land. Und man muss sagen, wenn es dieses Dreiergespann nicht gegeben hätte, also Swjatlana Zichanouskaja, Maryja Kalesnikawa, Weranika Zepkala, die ja letzten Endes für ihre Männer, die dann im Gefängnis oder im Ausland waren, eingetreten waren, hätte es diese Massenproteste nicht gegeben. Das Regime hat diese Frauen einfach unterschätzt. Sie waren Mutmacherinnen in dieser Situation.
Warum konnte sich das Lukaschenka-Regime trotz dieses Unmutes, aber auch des enormen Mutes und des Zusammenhaltes in sehr großen Teilen der Bevölkerung an der Macht halten?
Das Regime ist relativ schnell gegen die Führung dieser Massenproteste vorgegangen, schon in der ersten Woche waren 7.000 Menschen in Haft. Die Leute sind in den Gefängnissen nachweislich geschlagen und gefoltert worden. Auch das sollte Angst und Schrecken verbreiten. Es hat aber eigentlich die Proteste noch mehr angefacht, weil diese überbordende Gewalt in diesem umfassenden Maße viele Menschen tatsächlich nicht erwartet hatten und einfach zu viele betroffen waren. Zichanouskaja wurde relativ schnell außer Landes gezwungen, nach Litauen. Kalesnikawa wurde Anfang September 2020 festgenommen. Die Mitglieder des Koordinationsrates, also von dem Gremium, das eigentlich im Dialog mit dem Regime den Machttransit organisieren sollte, wurden relativ schnell festgenommen oder außer Landes getrieben. Irgendwann war die Protestbewegung sozusagen sich selbst überlassen. Selbstorganisation hat eine große Rolle gespielt, aber man braucht natürlich eine gewisse politische Führung. Und was noch wichtiger war: Das Regime ist nicht erodiert. Es gab zwar bei der Miliz, bei den Strafverfolgungsbehörden, bei den Diplomat*innen aus dem Regime einige, die ihre Loyalität gegenüber aufgekündigt haben, aber es waren einfach zu wenige, als dass das dem Regime hätte gefährlich werden können. Die Staatswirtschaft ist ein großer politischer Machtfaktor in Belarus. Es gab tatsächlich große Streiks und Proteste in einigen großen Werken. Das waren schon jeweils hunderte Leute, aber das reicht eben auch nicht bei Staatsbetrieben wo teilweise Zehntausende arbeiten. Auch da ist das Regime sehr konsequent vorgegangen: Es hat die Streikführer*innen relativ schnell verhaftet und die Arbeiter*innen unter Druck gesetzt.
Das alles zusammen führte dann auch dazu, dass die Proteste ab September keine zusätzlichen Menschen mehr mobilisieren konnte. Bis Oktober waren es 1,5 Millionen, die auf die Straße gegangen sind. Das ist bei einem Land von 9,2 Millionen sehr, sehr viel, aber es hätte wahrscheinlich noch mehr Menschen gebraucht, um dem Regime tatsächlich gefährlich werden zu können, vor allem aus dem Regime auch selbst.
Seitdem ist viel passiert. Belarus ist seit 2022 Komplize Russlands in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine geworden. Welche Rolle spielte Russland 2020?
Der Wahlkampf von Lukaschenka war damals tatsächlich sehr, man kann sagen, antirussisch, sehr auf die belarusische Unabhängigkeit fokussiert. Es sind damals ja auch mutmaßliche Wagner-Söldner in Minsk verhaftet worden, da war einiges an Unruhe im Gange und es gab im belarusischen Staatsfernsehen diskreditierende Beiträge gegen die russische Führung und vice versa. Das gab es in den letzten 20 Jahren immer wieder, dass man sich manchmal spinnefeind war, auch wenn man es nach außen als starke unerschütterliche Partnerschaft verkauft hat. Als die Proteste dann ausgebrochen sind, sind immer wieder gezielt Fake News, sicherlich aus Russland, aber auch von der belarusischen Propaganda gestreut worden, dass die russische Nationalgarde auf dem Weg nach Minsk sei, um die Proteste mit niederzuschlagen, um eben Angst zu schüren. Das hat auch dazu beigetragen, dass die die Funktionäre im Lukaschenka-Regime, sehr, sehr vorsichtig geworden sind bei der möglichen Entscheidung: „Schließe ich mich diesen Protesten an oder bleibe ich loyal?“ Vor diesem Hintergrund war es wahrscheinlich klar, dass die Proteste keine Chance haben würden, weil Putin das eben nicht zulassen würde. Als sich dann Lukaschenka mit Putin das erste Mal getroffen hat und dieser Milliardenkredit versprochen wurde, da wurde deutlich, dass all das, was vorher gegen Russland und Putin und die russische Führung gesagt worden ist, vergessen war und dass sich das Regime die Rückendeckung von Putin verschafft, um gegen diese Proteste brutal vorgehen zu können.
Diese Niederschlagung passierte dann bis 2022 in einer sehr hohen Geschwindigkeit auf sehr vielen parallelen Ebenen: eine Verschärfung der Strafgesetzgebung, eine Kriminalisierung der Leser*innen von unabhängigen Medien, die Vertreibung von unabhängigen Medien, das stringente Vorgehen gegen zivilgesellschaftliche Organisationen, und so weiter und so fort. Ich werfe diese Frage im Buch auf: Hat Putin sich sozusagen dazu entschlossen, das belarusische Territorium als Aufmarschgebiet für seine Vollinvasion zu nutzen, als er erkannt hat, dass durch diese Niederschlagung der Proteste der Raum dafür da war, der Protest nicht mehr da war, die Opposition nicht mehr da war, die Leute mittlerweile im Exil waren? Das ist eine Frage, die die Zukunft beantworten kann. Aber es hat ihm sicherlich geholfen, diese Entscheidung zu treffen.
Wie wichtig war die belarusische Identität bei diesen Protesten, oder auch der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit von Russland, hat das eine große Rolle gespielt?
Die Abhängigkeit zu Russland hat man tatsächlich versucht herauszuhalten, würde ich fast sagen. Man hat wirklich geglaubt, dass man eine inner-belarusische Angelegenheit, nämlich das Streben nach politischer Teilhabe, nach nationaler Selbstbestimmung, dass man das im Land selbst regeln kann. Das mag naiv gewesen sein, war aber ein ehrlicher Impuls. Man hat ja auch keine anti-russischen Losungen bei den Protesten gesehen, weil die Leute natürlich diese Bedrohung durch Russland verstanden haben. Man hat aber auch nicht im großen Stile EU-Flaggen gesehen, wie das bei den Protesten 2010 oder 2006 der Fall gewesen ist, stattdessen hat man die weiß-rot-weiße Flagge gesehen. Einerseits hat die Geschichte der belarusischen Freiheitsbewegung, weil die Flagge zum Symbol der Proteste geworden ist, eine Rolle gespielt. Es gab ja diese alten Bestrebungen der „Wiedergeburtsbewegungen“ ab Anfang des 20. Jahrhunderts, als Belarus sich als Nation formieren wollte oder dann wieder zur Zeit der Perestroika. Diese Narrative für die belarusische Sprache und Kultur haben bei den Protesten aber tatsächlich nur unterschwellig eine Rolle gespielt, würde ich sagen. Wenn wir von Identität und Werten sprechen, war das eher der Wunsch, sein Schicksal endlich selbst zu bestimmen, die Forderung nach politischer Teilhabe, ein Hunger nach Rechtsstaatlichkeit, nach demokratischen und fairen Regeln. Die nationale Identität ist ja ein sehr umkämpftes Konzept in Belarus, und wird auch von Regime-Seite beansprucht. In dieser identitären, nationalen Form hat das keine wirkliche Rolle gespielt.
Was können wir in Deutschland von den Belarus*innen lernen?
Nicht nur von Belarus: Wir haben das Streben nach Unabhängigkeit, Demokratie, Selbstbestimmung dieser ostmitteleuropäischen und osteuropäischen Länder zu lange unterschätzt. In den 90ern hat man das, was die Ukraine wollte oder Belarus wollte, eigentlich nicht wirklich wahrgenommen und unterstützt, auch in ihrer Abgrenzung gegenüber Russland.
In der heutigen Zeit, wo diese Freiheitsbewegungen nicht nur von Russland unter Druck gesetzt werden, sondern nun auch von Trump ist etwas, was wir sicherlich lernen können: Freiheit, demokratische Freiheit, fällt nicht vom Himmel. Man muss dafür jeden Tag einstehen, kämpfen, und im schlimmsten Fall Opfer bringen. Das kostet etwas. Es schmerzt. Und das ist das, was wir, bei den Belarus*innen und Ukrainer*nnen vor allem auch sehen. Wovon wir also von ihnen lernen können, ist die Resilienz und diese Kraft, die in diesen Bewegungen steckt. Bei den Ukrainer*innen ist das offensichtlich, bei den Belarus*innen vielleicht nicht so sehr. Aber auch im Exil ist das erstaunlich. Sie sind ja außer Landes getrieben worden, mussten dann in anderen Ländern ihr neues Leben aufbauen, Legalisierungsprozesse durchmachen, die von bürokratischen Herausforderungen geprägt sind, Kitaplätze für Kinder finden, Schulplätze, Arbeitsplätze, neue Sprache, neue Kultur. Die Leute waren häufig selbst im Gefängnis, sind gefoltert worden, traumatisiert. Und dann noch die Kraft aufzubringen, sich zu engagieren, also für die belarusische Gemeinschaft und für die Demokratiebewegung im Exil, dazu braucht man schon eine fast übermenschliche Kraft. Und davon kann man sicherlich von unserer Seite sehr viel lernen.
Das Interview führte Stefanie Orphal, Leitung Kommunikation am ZOiS.
Ingo Petz ist Journalist und Belarus-Redakteur beim Onlinemedium dekoder.
Ingo Petz: Rasender Stillstand. Belarus – eine Revolution und die Folgen, edition.fotoTAPETA, 2025.
